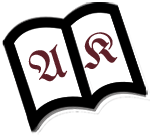Glockengießer
Das Berufsfeld des Glockengießers
Seit jeher behaupteten die Glockengießer ein freies Gewerbe auszuüben, welches dem Zunftzwang nicht unterliegt. Die Kölner Glockengießer waren meist nur im Nebenfach Glockengießer - sie beschäftigten sich oft als sogenannte Stückgießer auch mit der Herstellung von Rot- und Gelbguß (Bronzearbeiten, z.B. Krahnen, Duppen, Weihwasserkessel, Leuchter, Taufbecken, Tabernakel, Säulen, Mörser, Büsten, Kanonen)[1]. Deshalb schlossen sie sich dem Schmiedeamt an. Vorteil für sie war es deshalb, dass jeglicher fremde Wettbewerb ausgeschaltet war, auch wenn das eigene Können nicht ausreichte. Zahlreiche Fundstellen in den Ratsprotokollen zeugen von diesen Auseinandersetzungen.
Die Mitgliedschaft in einer Zunft wird gewöhnlich auch durch die Bezeichnung magister bzw. meyster kenntlich gemacht. Glockengießer sind fast nur in großen entwickelten Städten zu suchen und weniger in wirtschaftlich unbedeutenden Orten, auch wenn sie den Namen eines solchen Ortes manchmal als Herkunftsbezeichnung trugen.
Wichtig für die Glockengießerwerkstatt war die wirtschaftliche Versorgung mit Rohmaterial, wofür nur der Buntmetallmarkt größerer Städte geeignet war.
Die nachfolgenden Auflistungen der Kölner Glockengießer und deren Werkstätten sind den Forschungsveröffentlichungen von Joerg Poettgen entnommen.[2]
Kölner Gockengießer im 12. und 13.Jahrhundert
Auf den Glocken wurde in diesem Zeitraum noch kein Herstellervermerk angebracht. Es gibt aber in den Schreinskarten und anderen Urkunden gelegentlich den Vermerk zur Berufsbezeichnung Berufsbezeichnung.
Die Namen der Glockengießer (oft auch als campanator bezeichnet):
- Cuonradus
- Everhart
- Godefridus
- Tidricus
- Vordol Fusor
- Conradus
- Elias
- Marsilius
Die Gießer des 14. Jahrhunderts
Hier finden sich erste Inschriften auf der Glocke (Glockenzier). Neben einem Glockenspruch auf der ersten Zeile stehen dann in einer weiteren Zeile der Tag des Gusses und dann auch ein Gießervermerk.
- Arnolt
- Magister Hermanus
- Suardus (1313)
- Henricus de Ude(ne)ni - Heinrich von Oedt (1316-1338)
- Magister Sifride (1334/1335)
- Wilhelmus de Trajecto (1342)
- Sifridus (um 1350)
- Jacobus Fusor (1361)
- Johannes de Wynthere (1362)
- Conradus de Isbrochgen (1362)
- Cristianus Duppengiesser (1365)
- Magister Nicolaus Pastor (1368)
Kölner Meister der Spätgotik 1380 bis 1450
In diesem Zeitraum ergeben sich oft Probleme in der Namenszuordnung bei gleichem Familiennamen, so z.B. ob es sich um Vater und Sohn handelt, ob es Brüder waren oder ob es sich wie in einem Fall dann später nachgewiesen um Onkel und Neffen. Oft bleibt es aber auch unklar.
In Köln sind nun Gießereibezeichnungen mit den Namen Duisterwalt, Brodermann, Ouerraide, Alfter und Coellen zu finden.
In vielen Fällen bildeten sich in diesem Zeitraum auch Gießer-Arbeitsgemeinschaften aus unterschiedlichen Gründen: Spezialisierungen, Verordnungen durch die Verteilung von Gussmaterial, Einschränkungen von außerstädtischen Gießern.
- Johan Duisterwalt (1380-1415)
- Heinrich von Gerresheim/Rosengarten (1397-1409)
- Christian Duisterwalt (1400-1444)
- Gerhard Duisterwalt (1417-1418)
- Johann Wael (1410-1441)
- Kirsgen Kloit (1419-1462)
- Heinrich Brodermann (1423-1459)
- Arnt (Arnold) von S(i)egen (1429-1453)
- This von Mo(i)sbach (1431-1434)
- Ailf von Wippervorde (1442-1476)
- Johan Brodermann (1441-1449)
- Teil von Keppel (1443-1460)
- Tilman von Hachenburg (1444-1486)
- Johan Bruwiler (1445-1457)
- Johan Hoernken van Vechel (1444-1471)
- Sifart (=Syfart) Duisterwalt (1445-1464)
- Herman von Alfter (1448-1484)
Kölner Meister der Spätgotik 1450 bis 1550
- Johan Sursgyn (1460-1500)
- Johan von Alfter (1473-1518)
- Heinrich I. von Ouerraide (1474-1494)
- Herman von Nuis (1490-1491)
- Clais Richert (1495-1500)
- Johan von Ouerraide (1496-1519)
- Johan von Andernach (1475-1518)
- Heinrich II. von Ouerraide (1518-1547)
Die Werkstätten der Renaissance um 1540 bis 1625
- Johan Falkeborch [Johan von Coellen] (1535-1548)
- Derich Ouerraide [Derich von Coellen] (1546-1585)
- Heinrich von Wollersheim [Heinrich II. von Coellen] (1563-1594)
- Kerstgen von Unckel (1594-1625)
Die Meister des 17. Jahrhunderts
- Johann Reutter (1606-1636)
- Peter Kaufmann (1642-1647)
- Nikolaus Unckel (1627-1662)
- Johann Lehr (1650-1670)
- Nikolaus Wickrath (1669)
- Laurenz Wickrath (1673-1692)
- Johann Heinrich Wickrath (1684-1695)
- Johann Lukas Dinckelmeyer (1677-1691)
Die Meister des 18. Jahrhunderts
- Martin Pesch (1699-1717)
- Johann Piron (1701-1716)
- Matthias und Antonius Cobelenz (1703-1726)
- Edmund Pipin (1715-1733)
- Josef Paul Ku(e)s (1720)
- Gottfried Dinckelmeyer (1711-1733)
- Johann Heinrich Dinckelmeyer (1721-1742)
- Peter Fuchs (1700-1732)
- Carl Engelbert Fuchs (1724-1754)
- Johann Fuchs (1730-1771)
- Engelbert Josef Fuchs (1731-1756)
- Peter Heinrich Fuchs (1745-1778)
- Michael Moll (1730-1756) koelnerbuerger.de
- Bartholomäus Gunder (1736-1772)
- Heinrich Ross (1750-1756)
- Jakob Hilden (1753-1780)
- Franz Lambert Fuchs (1771-1777)
- Johann Joseph Fuchs (1790-1812)
- Jakob Claren (1772-1793)
Ausblick
Das Ende der Glockengießerei in Köln wurde mit dem Ende der Reichsstadt Köln eingeläutet.
Sicher haben noch einige Söhne der Glockengießerfamilien die Tradition fortgeführt, die Werkstätten standen aber nicht mehr in Köln.
Die Tradition wurde hier zwar fortgesetzt, jedoch wurde die Arbeitsweise und die Gestaltung durch die industrielle Fertigungsweise auf neue Wege gelenkt.
Im 19. Jahrhundert wurden die Aufträge z.B. nach Sieglar, Deutz, Metz, Frankenthal, Dresden und Apolda vergeben. Die bekannteste Großglocke für den Dom ("Decke Pitter") wurde 1923 an Heinrich Ulrich aus Apolda vergeben. Über diese weltweit bekannte Glocke darf man jedoch die Vielfalt der von Kölner Glockengießern geschaffenen Werke der letzten 700 Jahre nicht vergessen.