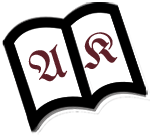St. Matthiaskapelle: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Mercatorplan, 1517 - Ausschnitt, Matthiaskapelle und Gelände des Heisterbacherhofes '''St. Matthias'''…“) Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:St-Mathias-Köln-Mercatorplan-1571.jpg|mini|Mercatorplan, 1517 - Ausschnitt, Matthiaskapelle und Gelände des Heisterbacherhofes]] | [[Datei:St-Mathias-Köln-Mercatorplan-1571.jpg|mini|Mercatorplan, 1517 - Ausschnitt, Matthiaskapelle und Gelände des Heisterbacherhofes]] | ||
'''St. Matthias''' war eine Kapelle an der Ecke der heutigen [[Mathiasstraße]] ("Voir St. Mattheis") und der [[Große | '''St. Matthias''' war eine Kapelle an der Ecke der heutigen [[Mathiasstraße]] ("Voir St. Mattheis") und der [[Große Witschgasse|Großen Witschgasse]]. Die Kapelle lag neben dem Heisterbacher Hof und wurde in Urkunden des Pfarrarchivs St. Severin 1311 erwähnt. Sie unterstand der Kirche St. Johann Baptist und wurde durch einen von dort beauftragten Rektor verwaltet. | ||
Die Kapelle lag neben dem Heisterbacher Hof und wurde in Urkunden des Pfarrarchivs St. Severin 1311 erwähnt. | |||
Die St. Matthiaskapelle nahm anfänglich das Unterhaus eines Giebelhauses in der Mathiasstraße ein. Das Obergeschoss der Kapelle war durch eine turmartig eingebaute Treppe an der Südostecke des Bauwerks zugänglich. Etwa zwei Meter vom Straßengiebel entfernt hatte der Dachfirst einen kleinen Glockenstuhl als Aufsatz erhalten. Die Außenmauern der Kapelle waren aus Tuffstein des 13. Jahrhunderts errichtet worden, jedoch ist ein genaues Entstehungsjahr der Kapelle nicht bekannt. | |||
St. Mathias wurde im Jahr 1803 geschlossen und fiel 1808 an die preußische Verwaltung. Das Gebäude wurde 1811 verkauft und später in ein Wohngebäude umgewandelt.<ref>Ludwig Arntz, Heinrich Neu, Hans Vogts: P. Clemen (Hrsg.): ''Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln.'' S. 346 f.</ref> | St. Mathias wurde im Jahr 1803 geschlossen und fiel 1808 an die preußische Verwaltung. Das Gebäude wurde 1811 verkauft und später in ein Wohngebäude umgewandelt.<ref>Ludwig Arntz, Heinrich Neu, Hans Vogts: P. Clemen (Hrsg.): ''Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln.'' S. 346 f.</ref> | ||
Version vom 21. Februar 2022, 16:37 Uhr
St. Matthias war eine Kapelle an der Ecke der heutigen Mathiasstraße ("Voir St. Mattheis") und der Großen Witschgasse. Die Kapelle lag neben dem Heisterbacher Hof und wurde in Urkunden des Pfarrarchivs St. Severin 1311 erwähnt. Sie unterstand der Kirche St. Johann Baptist und wurde durch einen von dort beauftragten Rektor verwaltet.
Die St. Matthiaskapelle nahm anfänglich das Unterhaus eines Giebelhauses in der Mathiasstraße ein. Das Obergeschoss der Kapelle war durch eine turmartig eingebaute Treppe an der Südostecke des Bauwerks zugänglich. Etwa zwei Meter vom Straßengiebel entfernt hatte der Dachfirst einen kleinen Glockenstuhl als Aufsatz erhalten. Die Außenmauern der Kapelle waren aus Tuffstein des 13. Jahrhunderts errichtet worden, jedoch ist ein genaues Entstehungsjahr der Kapelle nicht bekannt.
St. Mathias wurde im Jahr 1803 geschlossen und fiel 1808 an die preußische Verwaltung. Das Gebäude wurde 1811 verkauft und später in ein Wohngebäude umgewandelt.[1]
Eckdaten zur St. Matthiaskapelle
| Patrozinium | St. Matthias |
| Orden/Stift | |
| Gründung | vor 1311 |
| Aufhebung | 180e |
Literatur
- Arntz/Neu/Vogts (Bearb.): Franziskanerinnenklause S. Bonifatius. In: Paul Clemen/Hans Vogts/Fritz Witte (Hg.): Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz. Bd. 7, III. Abt., Düsseldorf 1937, S. 346 f.
Einzelnachweise
</references>
- ↑ Ludwig Arntz, Heinrich Neu, Hans Vogts: P. Clemen (Hrsg.): Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln. S. 346 f.